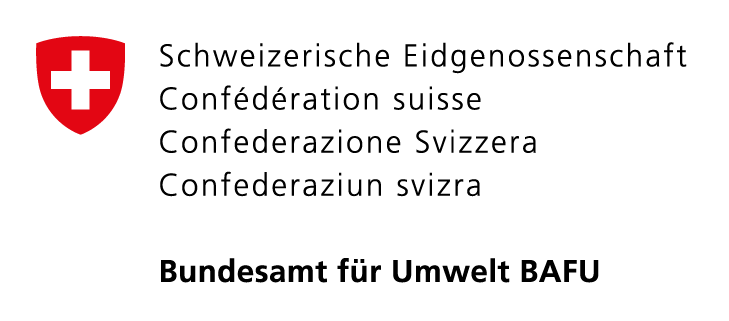Waldbericht 2025: Der Puls des Schweizer Waldes
Wie geht es unserem Wald? Zum dritten Mal nach 2005 und 2015 gibt der Waldbericht Antworten – mit umfassenden Einblicken in seinen Zustand, seine Entwicklung und seine Zukunft. Entdecken Sie hier die wichtigsten Erkenntnisse sowie weitere interessante Beiträge rund um den Wald!
Eine einzigartige Referenzpublikation
Rund neunzig Expertinnen und Experten haben die Informationen für den Waldbericht 2025 aus einer Vielzahl von Langzeitbeobachtungen gesammelt und in den sechs thematischen Kapiteln (s. unten) fachkundig interpretiert, um die relevanten Fragestellungen zu beantworten. Die Synthese liefert die Essenz der Forschungsergebnisse, und das Kapitel «Folgerungen» zeigt den politischen Handlungsbedarf für einen Wald auf, der sich den veränderten Umweltbedingungen anpassen und seine Leistungen auch künftig erbringen kann.
Er beantwortet anhand einer breiten Datenbasis aus Langzeiterhebungen wichtige Fragen für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Der Waldbericht richtet sich an Fachleute und an eine am Thema Wald und Holz interessierte Leserschaft. Mit seiner an den Berichten von Forest Europe orientierten Struktur liefert der Waldbericht international vergleichbare Ergebnisse und dient als einzigartige Referenzpublikation.
Folgerungen und Handlungsbedarf
Der Schweizer Wald steht unter Druck wie noch nie. Der Waldbericht 2025 zeigt die zunehmende Belastung unserer Wälder in den letzten 10 Jahren durch Extremereignisse wie Hitze, Trockenheit und Stürme, den Befall durch Schadorganismen oder die anhaltend hohen Stickstoffeinträge. Die Anpassungsfähigkeit der Wälder an den Klimawandel ist die grösste Herausforderung, um den Wald als resilientes Waldökosystem mit all seinen Leistungen, darunter besonders den Schutz vor Naturgefahren, zu erhalten. Die Förderung zukunftsfähiger Baumarten, die Verjüngung und die Reduktion des Wilddrucks sowie die weitere Förderung der Biodiversität spielen dabei eine zentrale Rolle.
Die Waldfläche soll in ihrer räumlichen Verteilung erhalten bleiben. Das gesetzlich verankerte Walderhaltungsgebot ist beizubehalten. Stressfaktoren wie Treibhausgasemissionen, zu hohe Stickstoffeinträge, die Ausbreitung von Schadorganismen und Waldbrände sind zu reduzieren.
Der adaptive naturnahe Waldbau ist weiterzuentwickeln und zu fördern, die integrative Waldbewirtschaftung ist verstärkt umzusetzen. Der Wald ist als Teil der Landschaft zu verstehen, der verschiedene Lebensräume landesweit vernetzt.
Die Wertschöpfungskette Wald und Holz muss sich von der Rohstoffproduktion über die Verarbeitung bis hin zur Nutzung der Produkte an die veränderten Bedingungen anpassen. Die Wald- und Holzwirtschaft kann zu einem wichtigen Element der Kreislaufwirtschaft werden und damit die umwelt- und klimapolitischen Ziele des Bundes unterstützen.
Um die Multifunktionalität des Waldes zu erhalten, müssen Konfliktfelder frühzeitig erkannt und in die forstliche Planung integriert werden. So können Lösungen auf Synergien statt auf Gegensätze ausgerichtet werden.
Ein verstärkter Dialog zwischen allen Akteuren und Interessengruppen im Bereich Wald und Holz sowie geeignete politische Rahmenbedingungen sind Voraussetzungen, um die vielfältigen Herausforderungen zu meistern.